Caesar Salad oder die gar seltsame Geschichte des erfolgreichsten Gerichts der italo-amerikanischen Küche – Ein Flüchtlingslager in Oberösterreich und ein unfassbarer Betrug in Mexiko
Fromme Seelen muss diese Stadt ans Fegefeuer erinnern: Die infernalische Melange aus chinesischem Nippes auf Bürgersteigen und gepantschtem Viagra in den Auslagen der Billigapotheken. Davor jauchzende US-Touristen auf Eseln, die mit schwarzen Streifen zum Zebra angemalt wurden, verfolgt von marmornen Blicken schwer bewaffneter Nationalgardisten auf Toyota-Pickups mit Maschinengewehr. Über allem der schrille Lärm einer kollabierenden Millionensiedlung an der wohl härtesten Wohlstandsgrenze der Welt. Tijuana, Zentrum der mexikanischen Provinz Baja California del Norte. Drogenmetropole, Welthauptstadt der Banden-Gewalt.

Welch Auserwähltem (bitte immer mit Reservierung!) sich aber die Tür zum Caesar’s Restaurant an der legendären Avenida de la Revolucion öffnet, der landet mit zwei kurzen Schritten in einer ganz anderen, heileren Welt. Hier sind Benimm und Geld zu Hause, hier hängen große Geschichten in schwarz-weiß-Fotografien über dunkel getäfeltem Mahagoni. Die Einrichtung ist bistro-klassisch, es duftet nach europäischem Wohlstand. Das hat natürlich Methode. Hier, im Vorzeige-Restaurant von Tijuana soll Küchengeschichte geschrieben worden sein: Die Erfindung des Caesar Salad. Der Caesar Salad, von der Chefkochvereinigung „Society for Epicures“ einst zum amerikanischsten aller Rezepte auserkoren, soll also eine mexikanische Erfindung sein?

Es ist der entscheidende Moment eines an sich relativ simplen Mischvorgangs: Oberkellner Fabricio Hernandez, elegant livriert samt tadellos weißem Hemd, gibt im Caesar`s Restaurant ein leicht angekochtes Ei in die in einer großen Holzschüssel bereits vorbereitete Vinaigrette. Er rührt, er schlägt und beginnt zu berichten. Just im Moment, in dem sich Senf und Salz, Pfeffer und Worchstershire-Sauce, Limettensaft, Olivenöl und Ei (wahlweise mit einer zerdrückten Anchovis) zu einer appetitlich-dichten Menge vereinen, breitet Hernandez eine Geschichte aus, wie man sie auf Basis einer Salatsauce wohl nur in der einst neuen Welt noch so unbefangen (und in freier Übersetzung des Autors) zu erzählen vermag:

„Es war einmal, als Livio Santini, ein junger Mann, kaum 20 Jahre alt, aus dem schönen Dorf Dro im Trentino stammend, das Heimweh überkam in der Wüstenfremde von Baja California. Dann nahm er sich in der Küche des Caesar’s Restaurant eine Holzschüssel zwischen die Knie, er gab Salz und Senf und all die anderen Zutaten hinzu und rührte, bis ihn die Bilder aus der Vergangenheit einholten: Das Lager in Braunau, der Hunger, Mutter Bice und ihr Salat.“

Wer mehr wissen will von Livio Santini und dem Caesar Salad, der findet im Netz schnell erste Spuren. Sucht man weiter, entfaltet sich mit der Geschichte des Rezepts ein Panorama von Krieg, Flucht und Vertreibung, von Armut und Wohlstand, Betrug und Wahnsinn; von verzweifelten Hoffnungen auf ein besseres Leben in einer neuen Welt, vom Tellerwäscher, der zum Millionär werden sollte – ein Panorama, in dem ausgerechnet Braunau, der kleinen österreichischen Stadt am Inn, eine zentrale Rolle zukommen soll.
Doch gilt es kurz innezuhalten. Offiziell und in fast allen Kochbüchern geht der Caesar Salad auf den aus der Lombardei stammenden US-Gastronomen Cesare Cardini zurück. Er, so berichtete seine Tochter schon in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, habe das Rezept ausgerechnet am US-Unabhängigkeitstag, dem 4. Juli 1924, in seinem Zweit-Restaurant in der boomenden mexikanischen Grenzstadt Tijuana kreiert. Auch das US-Kochidol Julia Child, eine der einflussreichsten Kochbuchautorinnen des 20. Jahrhunderts überhaupt, hat diese Story berühmt gemacht. Mitte der 20er Jahre soll Cardini den Salat in seinem Restaurant persönlich für sie und ihre Eltern angemacht haben.
Tatsächlich gibt es zur Geschichte dieses vordergründig so simplen Gerichts fast so viele Interpretationen wie zu seinem originalen Rezept. In Tijuana, das nicht nur das gleichnamige Drogenkartell, sondern auch eine quicklebendige italienische Community beherbergt, ist die Santini-Version inzwischen zur gültigen Geschichte des Salats geworden. Man bekommt sie auf drei Seiten Papier und in teils kryptischem Englisch im Caesar’s Restaurant ausgehändigt. Oder sie wird, wer das Glück hat, auf den Chef persönlich zu treffen, von Javier Plascencia erzählt, dem hochdekorierten Chefkoch und Miteigentümer des Caesar’s. Seine Familie hatte das runtergekommene Etablissement 2009 aus der Pleite gerettet und aufwendig restauriert. Heute ist es in der an historischen Überbleibseln denkbar armen Stadt Tijuana eine Ikone der Gutbürgerlichkeit, mit dem Caesar Salad als ihrem Zentrum. Dessen Geschichte geht für den, der es der Überlieferung entsprechend genau wissen will, folgendermaßen:

Das Städtchen Dro ist eine Idylle, einen guten Fußmarsch nur vom nördlichen Ufer des Gardasees entfernt, berühmt durch seine Felsmassen, den Marocche, die ein Gott einst hingeworfen haben soll ins Tal des Sarca-Flusses. Hier, die Quellen sind sich da nicht ganz einig, erblickt Livio Santini im Jahr 1905 das Licht der Welt. Noch ist sie heil, diese Welt, doch bald werden sich auch am südwestlichen Zipfel der Habsburger-Monarchie, zu der das Trentino damals gehört, erste Boten der bevorstehenden Katastrophe zeigen.
Als Österreich-Ungarn an der Seite des Deutschen Reichs im August 1914 in den großen Krieg zieht, muss auch Aldo Santini, Livios Vater, auf Seiten des Kaisers Franz Joseph zu den Waffen. Zu dieser Zeit hat das Kriegsministerium in Wien längst umfangreiche Pläne zu einer gewaltigen Evakuierungsaktion aus dem Grenzland zu Italien erarbeitet. Führende Köpfe in Wien fürchten, dass das Königreich Italien, obwohl offiziell noch Verbündeter Österreichs, auf Seiten der feindlichen Alliierten in den Krieg ziehen wird. Und so kommt es dann auch: Kaum ein Jahr nach Kriegsbeginn, am 24. Mai 1915 wechseln die Italiener die Fronten, Deutschland und Österreich sind jetzt der Feind und aus dem Paradies am Gardasee wird die „schwarze Zone“, ein Schlachtfeld, wie es das Trentino noch nicht gesehen hat.
Die Bevölkerung, italienischsprachig und damit aus Sicht der Wiener Kriegsbürokraten wenig verlässlich, soll nun binnen Stunden „ihre Sachen packen“. So heißt es in einem Eilbefehl des örtlichen österreichischen Armee-Kommandanten vom 22. Mai 1915. Zu Fuß und auf Karren geht es zur Provinzhauptstadt Trient, von dort aus per Reichsbahn über den Brenner irgendwo nach Österreich. Wohin genau, das weiß keiner der mindestens 75.000, die in diesen Tagen Hals über Kopf ihre Heimat verlassen müssen.
„Das war eine Flucht ins völlig Ungewisse“, sagt der Historiker Florian Kotanko. Der ehemalige Direktor des Braunauer Gymnasiums verströmt fröhliche Gelehrsamkeit, er ist belesen und hat fast jeden Meter der österreichisch-italienischen Fronten des Ersten Weltkriegs erwandert. Er hat sich für die österreichisch-trentinische Aussöhnung ins Zeug gelegt und ist Mitverfasser einer mehrere Hundert Seiten starken Studie: Braunau 1915-1918.

Foto: Buch Braunau L’Esodo
Kotanko erzählt detailreich, als wäre er dabei gewesen. Das Lager, nach heutigem Verständnis eine große Sammelunterkunft, sei noch nicht einmal als Plan fertig gewesen, als die Menschen aus Arco, Dro und Umgebung per Zug in die oberösterreichische Provinz verfrachtet wurden. „Zunächst sind sie also zu Tausenden auf Bauernhöfen der Region untergekommen“. Binnen Monaten entstand dann ein Lager aus 129 Holzbaracken für 12.000 Flüchtlinge aus dem Trentiner Grenzland. Keinen Kilometer davon entfernt war am 20. April 1889 ein gewisser Adolf Hitler zur Welt gekommen. Von dem Flüchtlingslager ist kein Stück mehr übrig. In das Geburtshaus Hitlers, das jahrelang leer stand, soll spätestens 2026 eine Polizeistation einziehen.
„Wir Trentiner sind für zwei Dinge besonders berühmt: unseren Fleiß und unseren Grappa“, sagt Renzo Tommasi. Der Professore, der auf den ersten Blick an einen Straßenmusiker erinnert, wohnt auf einer zugigen Burg nördlich von Trient, er findet, dass die Trentiner eine noch größere Autonomie von Italien haben sollten als es heute schon der Fall ist. Auch er hat über Livio Santini geforscht, allerdings nicht in Sachen Salat, sondern im Zusammenhang mit einer ganz anderen Fluchtbewegung aus dem Trentino: der Auswanderung nach Mexiko. Davon später mehr.
Die fleißigen Flüchtlinge aus dem Süden der Habsburger-Monarchie ziehen in Braunau unter der Regie des kaiserlich-königlichen Oberbaurats Anton Schedle ein kleines trentinisches Wunder hoch. Das Lager ist weit mehr als nur Behausung, es verfügt über eine eigene Stromversorgung, ordentliche sanitäre Einrichtungen, eine funktionstüchtige Kanalisation, mehrere Brausebäder, eine Dampfwäscherei, eine Bäckerei, eine große Küchenbaracke, die aus den lagereigenen Gärten, den Kuh- und Schweineställen samt angeschlossener Schlachterei versorgt wird. Und natürlich hat das Lager eine freundlich wirkende Holz-Kirche. „Am 13. September 1916 ist Livio Santini hier vom Linzer Diözesanbischof Gföllner gefirmt worden“, berichtet der Historiker.

Foto: Buch Braunau L’Esodo
Die Präsenz der Familie Santini in Braunau ist also aktenkundig. Vom Caesar Salad kann man das noch nicht behaupten. „Eine erstaunlich Geschichte“, sagt Magister Kotanko, als er von Tijuana und dem Caesar’s Restaurant hört – zum ersten Mal, wie er sagt. Sicher sei das Leben im Lager nicht immer einfach gewesen. Aber gerade deshalb sei der Caesar’s Salad ja passend für die Barackenstadt der Italiener von Braunau. „Eigentlich ein Arme-Leute-Essen.“
Der Historiker spricht von einer „weitreichenden Autarkie“ des Lagers in schwieriger Zeit. Salat aus den lagereigenen Gärten habe Bice Santini, Livios Mama, sicher stets zur Hand gehabt. Dann Essig, Öl, etwas Käse dazu, womit er fast schon fertig wäre, der Caesar Salad aus Braunau am Inn. Und durchaus denkbar, dass es im Lager manchmal auch Sardinen gegeben habe, mutmaßt Kotanko.
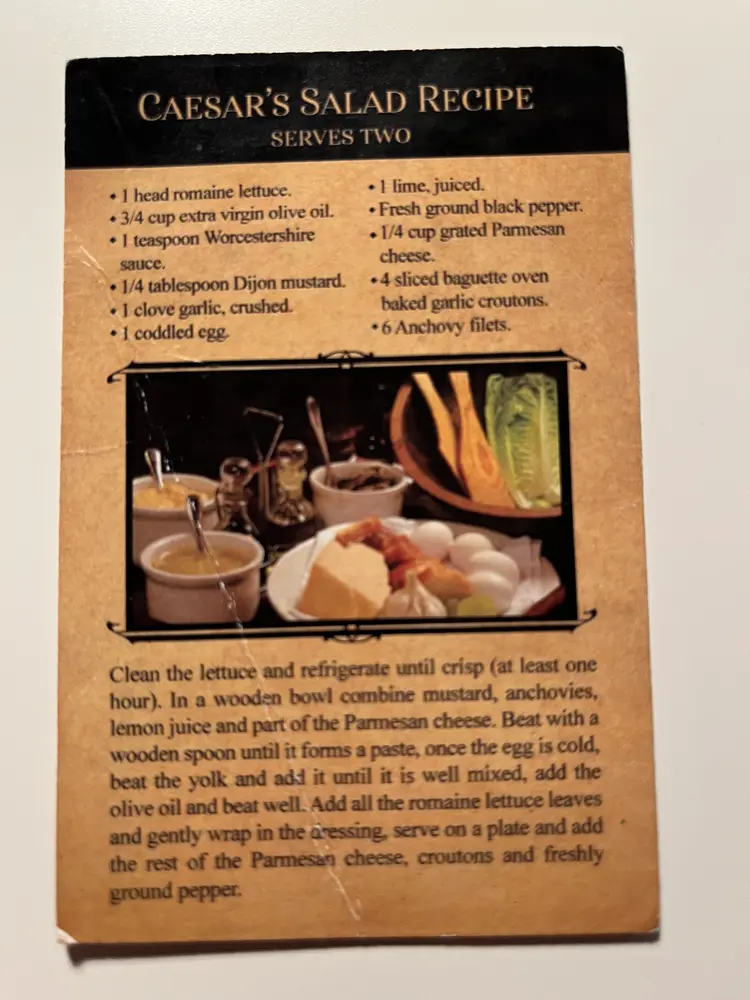
Dabei ist bis zum heutigen Tag wohl nichts im Rezept des Salats derart umstritten wie die Verwendung von Anchovis. Ob Los Angeles Taco oder New York Times, ob San Diego Chronicle oder auch die BBC, die Debatte, was in die Salatsauce gehört und was nicht, tobt bis heute. Während die Puristen den Fisch verschmähen, gilt er den meisten Kochbuchautoren als unverzichtbar.
In Braunau hat man 1916 andere Sorgen. Die berüchtigten Steckrüben-Winter stehen vor der Tür, für die Internierten beginnen ganz harte Zeiten. „Es gibt Berichte, wonach man sich auf den bereits abgeernteten Feldern um die Reste der Kartoffeln mit den Flüchtlingen gestritten hat“, erzählt der Historiker. Organisierte Fremdenfeindlichkeit habe es dennoch nicht gegeben. „Es waren ja im heutigen Sinn auch keine Fremden, sondern Bürger Österreichs“, sagt der Historiker. Hohen Besuch gab es auch. Im Februar 1916, kurz nach Fertigstellung, ist Alcide Degasperi vor Ort, damals Mitglied des österreichischen Reichstags. Er wird nach dem Zweiten Weltkrieg als italienischer Ministerpräsident zu einem der Gründerväter der Europäischen Union werden.
Ende Oktober, Anfang November 1918 bricht die österreichische Monarchie zusammen, der Krieg ist verloren. Es dauert aber noch Monate, ehe der schwierige Frieden mit Italien besiegelt ist und die Flüchtlinge zurückkehren dürfen in eine weitgehend verwüstete Heimat. „Mancherorts war hier kein Stein auf dem andern mehr“, berichtet Professore Tommasi.

Foto: Buch Braunau L’Esodo
Auch Familie Santini steht vor dem Nichts, eine halbwegs funktionsfähige Verwaltung des nun zu Italien gehörenden Trentino gibt es nicht. Die Trentiner nehmen die Dinge selbst in die Hand, Baugenossenschaften schießen aus dem Boden, aus einer solchen geht ich die Genossenschaft von San Cristoforo di Cardenazzo hervor. Nur hat diese sich nicht dem Wiederaufbau und der Heimat, sondern dem Neubeginn in der Ferne verschrieben. Denn es gibt viel zu wenig Arbeit, gerade für die jungen Leute . Mindestens 10.000 der etwa 300.000 Trentiner, so schätzt Prof. Tommasi, suchten vor 100 Jahren vergeblich nach Lohn und Brot. So beginnt eine weitere, noch unwahrscheinlichere Geschichte. Mit ihr kommt das Salatrezept aus dem Lager von Braunau über den großen Ozean in die neue Welt.
Es führte an dieser Stelle zu weit, alle Verwicklungen, Interessen und Abhängigkeiten zu schildern, die zur Verbindung Trentino und Mexiko geführt haben. Fakt ist, dass es viele persönliche Beziehungen in der katholischen Kirche und politische Interessen auf höchster Ebene gegeben hat. Während in Rom die Faschisten des Benito Mussolini nach der Macht greifen, wirbt im Trentino die Genossenschaft des Heiligen Christoph für ein Leben im Land Mexiko. „Leche y miel“ sollen dort fließen, Milch und Honig, ein katholisches Paradies. In Wirklichkeit ist das Land nach Jahrzehnten des Bürgerkriegs politisch gerade erst zur Ruhe gekommen und liegt ökonomisch am Boden.
Professor Tommasi hat die unglaubliche Auswanderungsgeschichte der Trentiner in die Hacienda „La Estanzuela“ im mexikanischen Bundesstaat Jalisco aufgearbeitet, inklusive des Werbefeldzugs, den die Genossenschaft San Cristoforo mit Unterstützung der Genossenschaftsbank von Trient ab 1922 lostritt. Sogar eine eigene Zeitschrift widmet sich fünf Jahre lang dem Thema: „L’Emigrante“ aus Rovereto.
Familie Santini fällt wie viele andere der Rückkehrer aus Braunau auf die Versprechungen der Kooperative San Cristoforo herein. Sie kratzt den letzten Heller zusammen und schickt den jungen Livio, damals gerade einmal 18 Jahre alt, auf eine Reise beinahe auf Nimmerwiedersehen, samt der 7000 Lire, die die Ausreise kostet. Das ist damals ein Vermögen, mindestens das Jahresgehalt eines Gutverdieners, so die Schätzung von Tommasi.
Die Fahrt der insgesamt gut 300 jungen Leute vom Südrand der Alpen in die Wüstenei des westlichen Mexiko ist en detail dokumentiert. Am 18. Mai bricht das erste Kontingent, 150 Kolonisten, per Zug nach Saint Nazaire an der französischen Atlantikküste auf. Zuvor hat man in Trient noch den Segen des Orts-Bischofs erhalten. In Frankreich schifft man sich auf die „L’Espagne“ ein und dampft nach Veracruz, den größten Atlantikhafen Mexikos. Dann geht es per Bahn landweinwärts. In der Hauptstadt Mexiko-Stadt wartet sogar der Landwirtschaftsminister auf die Neuankömmlinge, er ist italienischer Herkunft und hat ebenfalls für das Projekt getrommelt. Ob er weiß, was es mit La Estanzuela auf sich hat?
Versprochen hat man ihnen eine goldene Zukunft in einem Land unbegrenzter Chancen. Umgerechnet 11 Millionen Dollar soll die Hacienda wert sein, hat eine eigens durch Mexiko gereiste Gutachterkommission behauptet. Doch als die Italiener nach gut 20 Tagen Reisestrapazen am 11. Juni 1924 in La Estanzuela ankommen, ist von der einst blühenden Landwirtschaft nichts mehr übrig. „Eine verwüstete Fläche, zerstörte Gebäude und Skelette anstelle von Herden“, erzählen es später die Nachkommen. Die traurigen Trümmer der Hacineda stehen bis heute und sind auch auf youtube zu finden.
Doch das Schlimmste kommt noch: Die Besitztitel, die die Kolonisten haben, sind das Geld nicht wert, das sie schon in Italien dafür bezahlt haben. Bald stellt sich heraus, dass der Großgrundbesitzer, dem die Hacienda auf dem Papier gehört, quasi enteignet worden ist. Die noch junge Reform-Regierung Mexikos hat eine Landreform durchgesetzt, die Hacienda wird nun von den ehemaligen Tagelöhnern selbst bewirtschaftet. „La Estanzuela, das war ein einziger Betrug“, sagt Renzo Tommasi.
Zwar versuchen die Kolonisten, zu retten, was zu retten ist und sich mit den Einheimischen zu arrangieren. Doch spätestens nach einem Dreiviertel Jahr haben die Letzten aufgegeben. Die Trentiner verstreuen sich in alle Ecken Mexikos, den begleitenden Pfarrer verschlägt es samt seiner Haushälterin sogar bis Buenos Aires. Zwei Hauptströme der Flucht hat Renzo Tommasi ausgemacht, der eine führt in die zahlreichen Minen des Landes, der andere schnurstracks nach Norden, in Richtung USA, damals das eigentliche gelobte Land.
Was Livio Santinti womöglich ignoriert: Die Vereinigten Staaten haben ihre Grenzen fast komplett dicht gemacht, nur noch handverlesen kommen Einwanderer ins Land. Und die katholischen Italiener haben besonders schlechte Karten. So strandet der 21-jährige Livio wohl 1926 endgültig in Tijuana. Das ist damals fast noch ein Nest, hat etwa 5.000 Einwohner und eigentlich nur zwei Hauptstraßen. Aber nicht mehr lange. Denn Tijuana hat das, was die USA, was Hollywood und San Diego zu dieser Zeit zumindest offiziell nicht haben: Alkohol. Damals beginnt die Geschichte der Drogenmetropole Tijuana: „Viele meiner Landsleute haben sich mit Schnapsbrennerei ein kleines Vermögen verdient“, schätzt Professor Tommasi.
Ob Livio dazugehört? Später wird er jedenfalls ein reicher Mann sein, er nennt ein Restaurant sein eigen („Santini’s“), baut das erste Motel der Stadt, hat ein großes Immobilienbüro und erheblichen Anteil am zwischenzeitlichen Aufstieg der Millionenstadt Tijuana. „Im italienischen Viertel geht es bis heute gutbürgerlich zu, da stehen viele sehr ansehnliche Häuser“, sagt Tommasi, der die Nachkommen Livios 2006 besucht und für sein Buch interviewt hat.

Begonnen in Tijuana hat Livio Santini als Tellerwäscher. Bald nach seiner Ankunft fällt er dem US-Gastronomen Cesare Cardini auf – und der heuert ihn als Hilfskraft für seine Küche an. Livio darf sich auch als Hilfskoch verdingen, und, wir haben es schon gehört, rührt sich seinen Salat an.
Er steigt schnell zum Chef des Restaurants auf, macht Bekanntschaft mit General Abelardo Rodriguez, der dort zu speisen pflegt und später sogar kurz mexikanischer Präsident werden sollte. Rodriguez, seinerzeit Gouverneur der Provinz Baja California, ist es auch, der Mitte der 20er Jahre die Kasinostadt Agua Caliente am Rande von Tijuana mit aus dem Boden stampft. Agua Caliente, das ist Las Vegas auf mexikanisch, mit Spielhöllen und Tequila-Schwemmen, gekrönt von einer seinerzeit berühmten Pferderennbahn. Clark Gable und andere Größen von Hollywood geben sich ihr Stelldichein, ja selbst Al Capone soll da gewesen sein. All das hat die Wüste längst wieder verschluckt. Das gefährliche Gebräu aus Drogen, Geld, Korruption und Gewalt aber, das Mexiko bis heute plagt, ist damals schon allgegenwärtig.
Mit einer silbernen Zange greift Oberkellner Hernandez die einzelnen Salatblätter aus der Holzschüssel und legt sie vorsichtig auf eine Porzellanplatte. Er gibt nur zwei geröstete Scheiben Baguette obenauf, zuvor mit Knoblauch abgerieben. Fertig ist die Köstlichkeit. Er erzählt, es sei „Sussi“ Sullivan gewesen, die Erbin einer der großen Zuckerplantagen auf Kuba, die Livio Salvini vor fast 100 Jahren in der Küche besucht und sein Salatrezept mit nach Norden, in die High-Society von Hollywood, genommen habe.
Livio Santini ist 1995 in Tijuana im Kreis seiner großen Familie gestorben. Er hat allerhand durchgemacht in seinem langen Leben, ist mindestens einmal geschäftlich auch auf die Nase gefallen. Hat sich aber immer wieder berappelt, als Gastronom, Hotelier, Immobilienentwickler. Späte Berühmtheit hat ihm in Tijuana sein Salat gebracht. Er muss diese Geschichte hundertfach erzählt haben, auch in seiner Heimat, in die er in den 70ern kurzzeitig zurückkehrte. Estrella Santini, Livios Ehefrau, hat Livios Geschichte natürlich auch Professor Tommasi vorgetragen und der hat sie in seinem Buch aufgeschrieben:

Foto: C. Hardt
„Dann übertrug man ihm die Verantwortung für die Zubereitung von Salaten. Zu dieser Zeit gab es große amerikanische Händler, die Partien kubanischen Zuckers kauften. Eines Tages kam die Frau eines dieser Händler in die Küche und bat Livio, ihr etwas Leichtes zu machen, und mein Mann machte ihr einen Salat, den seine Mutter in Braunau gemacht hatte, als sie im Konzentrationslager waren. Er erinnerte sich, dass es viel Salat und hartes Brot gab, das sie nicht wegwarfen, und ein kleines Stück Käse. Also machte seine Mutter Salat, ein paar Eier, geriebenes hartes Brot und dann Käse und Livio erinnerte sich an den Salat und machte diesen Salat an diesem Tag. Die Frau sah ihn und fragte nach einem ähnlichen Salat, und so ging er hinaus, um ihn im Restaurantsaal zu essen, und alle wollten ihn probieren. Von da an begann der Ruhm des Salats. Natürlich konnten sie ihn nicht Livio Santini nennen, sie nannten ihn Ensalada Cesar, nach dem Namen des Restaurants, in das sehr wichtige Leute gingen, wie der Gouverneur von Niederkalifornien.“
Bis aufs Letzte wird man die Geschichte dieses wie auch immer sehr amerikanischen Gerichts kaum mehr aufklären können. Aber wozu auch? Vieles spricht dafür, dass der Caesar Salad auch trentinisch-oberösterreichische Wurzeln hat. Wobei das Innviertel, an dessen westlichem Rand Branau liegt, überhaupt erst vor gut 200 Jahren zu Österreich gekommen ist – und vorher stets bayrisch war. Aber lasssen wir das. Wie sagte es die Mutter aller amerikanischen Kochbücher, Julia Child, einst so treffend: „Wie kann ein so simpler Salat nur derart gewaltige Emotionen verursachen?“